Visits: 1987
Abbildung 1 Erkennt sich ein Affe vor dem Spiegel? Erkennt ein Affe, ob sich ein anderer Affe vor dem Spiegel erkennt?Philipp Wehrli, 1995, überarbeitet und veröffentlicht: 1. Juni 2006
Die meisten Menschen sehen in Lernfähigkeit, Intelligenz und bewusster Selbsterkenntnis eine grosse Stärke. Ich zeige an Beispielen aus der Tierwelt, dass Lern- und Denkfähigkeit im Gegenteil in den meisten Fällen ein Luxus oder sogar eine grosse Gefahr darstellt und dass Tiere deswegen nur in ausgewählten Fällen lernen. Überlegungen, unter welchen Bedingungen sich Lern- und Denkfähigkeit auszahlt, führen mich zum Schluss, dass keine Tierart ausser dem Menschen versucht, sich ein vollständiges Weltbild zu schaffen. Philosophen gibt es nur unter den Menschen.
Natürlich ist die Interpretation der Tierbeobachtung von der Geisteshaltung des jeweiligen Forschers abhängig. Bertrand Russell bemerkte zu dieser Frage überspitzt: „Tiere, die von Amerikanern studiert werden, wuseln eifrig und betriebsam mit geradezu unglaublichem Elan umher und kommen schliesslich durch Zufall zum gewünschten Ergebnis. Von Deutschen beobachtete Tiere sitzen still, denken nach und finden schliesslich die Lösung aus innerer Erleuchtung heraus.” (Cal 1)
Trotz diesem Ermessensspielraum gibt der folgende Texte einig Anhaltspunkte, wie die Frage erforscht werden kann und welche Argumente eine Rolle spielen.
1. Das Weltbild der Hühner
2. Werkzeuggebrauch bei Wespen
3. Wie viel ist angeboren, wie viel ist erlernt?
4. Der Vorteil der Lernunfähigkeit
5. Zeitliche Beschränkung der Gefahr
6. Sprache als Multiplikator des Vorteils
7. Rentabilität des Lernens bei Schimpansen
8. Gibt es philosophierende Schimpansen?
9. Weiterführende Artikel auf dieser Homepage
10. Bücherempfehlungen
1. Das Weltbild der Hühner
Ein Experiment von W. R. Holst zeigt, dass in der Tierwelt auch hoch komplexe Verhaltensmuster oft nicht das Resultat eines Denkvorganges sind, sondern auf angeborenen Instinkten beruhen (Dit 1).
R. Holst untersuchte Hühner, indem er elektrische Sonden in ihr Zwischenhirn führte und so sehr gezielt einzelne Hirnstellen reizte. Dies ist für die Tiere völlig schmerzlos, da das Gehirn ein schmerzunempfindliches Organ ist, wie auch Menschen nach Operationen bestätigten.
Es zeigte sich, dass einige Stellen in diesem Zwischenhirn ‘stumm’ sind, d. h. zu keinen äusserlich beobachtbaren Reaktionen führen. Vermutlich resultieren aus den Reizungen ‘stummer’ Gehirnstellen lediglich nicht beobachtbare innere Stimmungsänderungen. Die Reizung streng begrenzter anderer Stellen hatte aber bei den Hühnern stets sehr komplizierte und doch vollkommen koordinierte Verhaltensmuster zur Folge, die insofern natürlich waren, als sie den Verhaltensmustern frei lebender Hühner vollständig entsprachen.
Holst reizte mit seiner Sonde eine kleine Stelle im Hühnergehirn. Dieser Reiz bewirkte, dass das Huhn in Abhängigkeit vom gereizten Hirnareal entweder fiktive Körner aufzupicken begann, einen unsichtbaren Feind angriff, vor einem Raubtier floh oder in nicht vorhandenem Sand scharrte.
Das Huhn machte dabei keine absurden Verrenkungen oder Tänze. Es folgte vielmehr offensichtlich einem Muster, das es im täglichen Leben immer wieder brauchte. Die Verhaltensmuster für eine grosse Anzahl möglicher Lebenssituationen eines Huhnes sind von Geburt an im Hühnergehirn gespeichert und zwar jeweils an einer sehr eng begrenzten Stelle.
Weitere Experimente zeigen, dass nicht nur die Verhaltensweisen, sondern auch ihre Auslöser bei vielen Tieren angeboren sind. Z. B. ein Huhn reagiert auf ein bewegtes, wieselgrosses Ding mit Fell instinktiv mit Flucht oder Verteidigung, auch wenn es nie zuvor ein Wiesel gesehen hat.
Solche ganz einfachen Erkennungsmerkmale spielen in der Natur eine enorme Rolle. Vitus Dröscher berichtet von Wapitis westlich des Winnipeg-Sees, die eine Dampflok lediglich ihres Warn-Tutens wegen für Rivalen hielten und angriffen, was wiederholt zu Unfällen führte. Das Erkennungszeichen ‘Tuten’ war bei diesen Hirschen der angeborene Schlüsselreiz zum Angriff gegen einen Rivalen. Selbst wenn die Lokomotiven äusserlich nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem Wapiti hatten, so blieben sie dennoch Rivalen. Denn ein Wapiti achtet gar nicht auf das Äussere seines Gegners. Das Tuten hatte seit Jahrtausenden als Erkennungszeichen ausgereicht (Drö 1).
Wir finden unzählige vergleichbare Beispiele in der Natur. Geräusche, Farbflecken oder Muster, Düfte, eine Körperhaltung, eine Körpergrösse oder auch beliebige Kombinationen dieser Eigenschaften können die angeborenen, auslösenden Reize für fest vorgegebene Verhaltensmuster sein.
Ein Fisch- oder ein Vogelmännchen sucht nicht nach einem Fisch- oder Vogelweibchen. Es sucht nach einer ganz bestimmten Farbe, nach einer ‘schönen’ Bauchwölbung oder nach einer speziellen Fiederung. Solche Reize ziehen die Tiere an, egal ob die anreizende Farbe nun ein Weibchen ziert oder nur einen Holzklotz mit einer völlig anderen Form. Analog verhält es sich in vielen Fällen beim Erkennen von Feinden, bei der Futtersuche oder beim Verhalten gegenüber Gruppenangehörigen.
Allerdings dürfen wir derartige Beispiele nicht überinterpretieren. Nur weil es Beispiele gibt, in denen Tiere einen Holzklotz wie einen Geschlechtspartner behandeln, dürfen wir noch nicht glauben, ihr ganzes Leben bestünde ausschliesslich aus blinden, angeborenen Reaktionen auf die Umwelt.
Immerhin muss darauf hingewiesen werden, dass kaum ein Tier sich derart leidenschaftlich mit mehr oder weniger primitiven Abbildungen von Geschlechtspartnern befasst wie der Mensch. Wir bewundern solche Abbilder – insbesondere des weiblichen Körpers – als Kunstwerke, wir hängen sie zu Werbezwecken in die Strassen, drucken sie in unsere Zeitungen. Wir sehen diese Abbilder, die zum Teil wirklich nicht mehr als einfache Strichzeichnungen oder Holzklötze mit geeigneter ‘Bauchwölbung’ sind, auf Schritt und Tritt. Es wäre naiv zu glauben, die pornographischen Utensilien, mit denen sich viele Männer verlustieren, seien einer lebenden Frau wesentlich ähnlicher als die bemalten Holzklötze einem Fischweibchen.
Holsts Hühnerexperiment zeigt nicht, dass Hühner immer und ausschliesslich einem primitiven Reaktionsmuster folgen. Aber das Experiment zeigt, dass einem Tier ganze Reaktionsmuster samt ihren Auslösern angeboren sein können, nämlich eben zum Beispiel das Feindbild des Wiesels, welches das Huhn noch nie zuvor sah.
Ein Huhn ist trotz seinem starr vorgegebenen Weltbild nicht ein mechanischer und exakt voraus berechenbarer Apparat. Gerade das Beispiel Ernährung zeigt deutlich, dass das Verhalten stark von der inneren Situation des Huhnes abhängt. Hat ein Huhn lange nichts gegessen, so sinkt die Reizschwelle zur Nahrungsbeschaffung und das Tier ist leichter bereit, auch Dinge als Nahrung zu behandeln, die nicht exakt dem inneren Bild für ‘Nahrung’ entsprechen. Ein sehr hungriges Huhn beginnt sogar, lediglich eingebildete Körner ‘aufzupicken’.
Zudem ist ein Verhalten im allgemeinen nicht rein, sondern eine Mischung von mehreren Neigungen, wie Angst vor einer bedrohlichen Situation und Hunger oder Muttertrieb. Da die innere Stimmung ständig wechselt, verhält sich auch ein sehr einfaches Tier auf dieselbe Reizsituation stets wieder anders, wenn auch nur in Nuancen.
2. Werkzeuggebrauch bei Wespen
Wie kompliziert angeborene Verhaltensweisen auch schon bei einfachen Tieren sein können, zeigt das Beispiel der Sandwespen. Die Sandwespenweibchen vergraben ihre Eier zusammen mit einer gelähmten Raupe und benützt danach einen Stein, um die Erde festzustampfen und dadurch ihre Brut zusätzlich vor Räubern zu schützen.
Was auf den ersten Blick nach einer unglaublich intelligenten und vorausschauenden Erfindung aussieht, beruht aber lediglich auf ganz einfachen Reflexen, wie das folgende Experiment zeigt: Bevor ein Wespenweibchen die Raupe in die bereits vorbereitete Grube legt, kriecht es noch einmal in das Loch hinein, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist. Wenn ein Experimentator in diesem Moment die Raupe ein wenig zur Seite legt, so wird die Wespe diese zuerst wieder vor ihr Loch schleppen und dann ein weiteres Mal die Grube überprüfen. Es könnte sich ja tatsächlich etwas geändert haben. Nun kann aber ein sadistisch veranlagter Experimentator das Spiel beliebig weiter treiben. Denn selbst wenn die Wespe die Raupe hundertmal zum Loch zurück schleppen muss und hundertmal das Loch kontrolliert und hundertmal feststellt, dass alles in Ordnung ist, so wird sie dennoch das Loch ein weiteres Mal überprüfen. (Die Wespe hat offensichtlich diese Internetseite nicht gelesen und kennt deshalb die Induktion nicht).
Dieses Verhalten würde bestimmt niemand intelligent nennen. Es beruht aber nicht einmal auf einem Instinkt, wird also auch nicht durch einem Gefühl der Unsicherheit oder der Angst um ihre Brut hervorgerufen. Es ist schlicht ein Reflex, ein mechanisch und unabänderlich stets gleich ablaufendes Verhaltensmuster. Denn die Wespe muss bei diesem Spiel bis zur Erschöpfung mittun (Sta 1).
Intelligentes Verhalten wie zum Beispiel Werkzeuggebrauch kann also verschiedene Beweggründe haben. Man müsste zumindest unterscheiden zwischen instinktivem (also angeborenem), erlerntem und selbst erfundenem Werkzeuggebrauch. Erst die Fähigkeit, Neues zu erfinden, weist auf eine gewisse Denkfähigkeit hin.
3. Wie viel ist angeboren, wie viel ist erlernt?
Die Frage, wie viel unseres Wissens oder unseres Charakters erlernt oder anerzogen ist und wie viel angeboren, wird seit Jahrhunderten von Philosophen und Pädagogen diskutiert. Zwei Experimente zeigen, dass manche Fähigkeiten, die als Anlage von Geburt auf vorgegeben sind, dennoch erlernt werden müssen.
Sobald die Theorie eines starr angeborenen Weltbildes auftaucht, melden sich auch bereits ihre Gegner. Dem Huhn mag ein fixes Weltbild angeboren sein, dem Hund aber bestimmt nicht, wird protestiert. Dieser Protest ist nicht aus der Luft gegriffen, er stützt sich im Gegenteil auf eine breite experimentelle Basis. Von sehr vielen Reaktionsweisen höherer Tiere kann eindeutig nachgewiesen werden, dass sie erlernt sind.
Bekannt ist z. B. ein Experiment mit Kätzchen, die von Geburt auf in einem Raum gehalten wurden, in dem lediglich senkrechte Gegenstände zu sehen waren. Im Alter von einigen Wochen wurden sie in eine normale Umgebung gebracht, waren dort aber absolut unfähig, mit waagrechten Gegenständen umzugehen. Sie konnten nur mit grosser Mühe und unter Kopfverdrehungen eine Treppe hinaufsteigen. Auf einen normalen Stuhl zu springen, wurde zu einem kaum lösbaren Problem. Die Kätzchen hatten es offenbar verpasst, in ihrer Lernphase die Wahrnehmung waagrechter Gegenstände zu schulen.
Wenn aber ein Kätzchen selbst so fundamentale Dinge wie alle waagrechten Gegenstände erlernen müssen, so kann ihnen ja wohl kein fertiges Weltbild angeboren sein!
Wir haben also unwiderlegbare Beweise, dass manche Tiere selbst fundamentale Teile ihres Wissens erlernen müssen, und wir wissen von Holsts Hühnerexperimenten, dass zumindest Hühner ein fast vollständiges Weltbild angeboren mitgeliefert bekommen. Sind nun die Hühner Ausnahmen? Oder sind die Experimente falsch? Ist der grösste Teil unseres Wissens angeboren? Oder müssen wir fast alles, was wir wissen wollen, erlernen?
Der Amerikaner Gene Sackett zeigte, dass viele Tiere grosse Teile ihres Wissens über die Welt erlernen müssen, obwohl es ihnen bereits angeboren ist (Eib 1). Sackett zog einzelne Rhesusaffen völlig isoliert von anderen Affen auf und gab ihnen auch keinen Spiegel, um sich selbst darin betrachten zu können. In Experimenten führte er ihnen aber Dias vor, die unter anderem auch Rhesusaffen abbildeten. Ausserdem gab er den Affen die Möglichkeit, selber die Bilder zu wählen, indem sie einen bestimmten Hebel betätigten. Es zeigte sich sehr bald, dass die Affen Affenbilder vor Bildern mit Landschaften oder Menschen bevorzugten.
Unter den Affenbildern war nun eines, auf dem ein drohender Artgenosse zu sehen war. Dieses Bild gehörte zunächst eindeutig zu den bevorzugten Bildern, weil es ja einen Affen zeigte. Im Alter von zweieinhalb Monaten änderte sich diese Vorliebe drastisch. Noch immer blieben Affenbilder klare Favoriten. Der drohende Affe aber löste plötzlich offensichtlich Angstreaktionen aus. Die Versuchstiere wichen ängstlich zurück und umklammerten sich selbst, wobei sie Angstlaute ausstiessen. Gleichzeitig sankt die Beliebtheit dieses Bildes rapide ab. Es wurde fortan nach Möglichkeit vermieden.
Da die Rhesusaffen nie irgendwelche Kontakte mit Artgenossen hatten, konnten sie die Drohgebärde nicht mit negativen Erfahrungen in Verbindung bringen. Ihre Angst vor Drohgebärden musste ihnen angeboren sein. Sie ist aber nicht nur angeboren, wie man aus dem obigen Experiment schliessen könnte. Sie entwickelt sich nicht zwangsläufig im Alter von zwei Monaten. Aus anderen Experimenten weiss man, dass Affen die in ihrer Jugend isoliert gehalten wurden, die also auch keine Bilder gesehen haben, in einer Affengruppe grosse Probleme haben, unter anderem weil sie eine Drohgebärde nicht als solche erkennen und falsch reagieren. Rhesusaffen benötigen also das Bild eines drohenden Affen, um das in ihnen schlummernde Bild zu aktivieren.
Diese Einrichtung ist durchaus sinnvoll. Einerseits ist es überlebensnotwendig, das Bild des drohenden Affen instinktiv zu kennen und richtig darauf reagieren zu können. Andererseits wäre es bei den hochentwickelten sozialen Beziehungen der Rhesusaffen unsinnig, die Drohgebärde losgelöst von den Gruppenmitgliedern zu kennen. Vielmehr ist es von Vorteil, die Drohgebärde als Charakterzug ganz bestimmten Individuen zuzuordnen. Dies geschieht am einfachsten, indem dem angeborenen Phantom ‘Drohgebärde’ je nach Erfahrung ein bestimmtes Gesicht zugeordnet wird. So ist es möglich, je nach Fall viel differenzierter zu reagieren. Weil Affenkinder kaum angegriffen werden und eine gewisse Narrenfreiheit haben, erwächst aus dem Lernvorgang normalerweise auch keine Gefahr.
4. Der Vorteil der Lernunfähigkeit
Die Evolutionstheorie lehrt uns, bei allen Eigenschaften von Lebewesen nach dem Nutzen zu fragen. Die Lernfähigkeit, die uns Menschen überlebenswichtig erscheint, bringt aber keineswegs nur Vorteile, sondern vor allem ungeheure Kosten. Nicht lernen zu müssen und daher nicht den Gefahren des Lernens ausgesetzt zu sein, ist ein grosser Vorteil.
Wie Holsts Untersuchung an Hühnern zeigt, wird einem Huhn bei der Geburt ein fast vollständiges Weltbild, mit allen für ein Huhn relevanten Details mitgeliefert. Dies bedeutet natürlich, dass ein Huhn nichts mehr zu lernen braucht. Ein Huhn kann es sich erlauben, absolut lernunfähig zu sein. Dies hat einen unschätzbaren Vorteil: Das Huhn verhält sich in jeder Situation prinzipiell richtig.
Es braucht nicht erst in schmerzhafter Erfahrung zu lernen, dass ein Wiesel etwas Böses ist. Es weiss das schon mit der Geburt. Es braucht auch nicht verschiedene Kampftechniken zu testen. In jahrmillionenlanger Evolution sind aus Generationen von Hühnern diejenigen ausgelesen worden, die instinktiv richtig kämpfen. Es braucht auch nicht verschiedene Nahrungsmittel auszuprobieren und sich damit der Gefahr einer Vergiftung auszusetzen. Das Gehirn sieht zum vornherein nur diejenigen Dinge als Nahrung, die für Hühner geeignet sind.
Ein Huhn ist dank seiner Lernunfähigkeit geborgen. Lernfähigkeit bedeutet eine Schwächung der bewährten Instinkte. Lernfähigkeit setzt ein weltoffenes, unwissendes Fragen voraus und liefert damit das lernende Lebewesen den möglichen Gefahren eines falschen Verhaltens aus.
Den gewaltigen Nachteil des Lernenmüssens sieht man nirgends so deutlich wie beim Menschen. Beim Menschen wird die enorme Lernfähigkeit, beziehungsweise das damit verbundene geburtliche Unwissen, zu einem ernsthaften Problem. Während den ersten zehn Jahren ist ein Menschenkind ständig in akuter Gefahr, weil es noch nichts oder fast nichts von der Welt weiss. Wäre aber dem Menschenkind wie dem Huhn ein Weltbild angeboren, so wäre die Lernmotivation enorm geschwächt. Das Menschenbaby muss hilflos und unwissend auf die Welt kommen, um lernen zu können. Der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier ist die Unwissenheit und Hilflosigkeit des Menschen bei der Geburt und in der Kindheit. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass die Selektion einen derartigen Nachteil nicht eliminierte.
Es mag überraschen, dass Lern- und auch Denkfähigkeit keineswegs in jeder Situation ein Vorteil ist. Zum Beispiel wird bekanntlich im Militär unter grossem Aufwand versucht, den Soldaten so weit als möglich das Denken abzugewöhnen. Dies ist nicht so unbegründet, wie speziell die intelligenteren Rekruten im allgemeinen glauben. In sehr vielen Fällen können kritische Situationen tatsächlich am besten gemeistert werden, wenn nicht zu viele Leute mitdenken und dreinreden.
Gerade wo es um das Gemeinwohl geht, ist es für die Gruppe oft ein Nachteil, wenn der Einzelne zu sehr denkt, denn das Ziel der Gruppe unterscheidet sich sehr oft vom Ziel des Einzelnen. Als denkende Wesen verlieren wir deshalb eine enorme Energie dabei, mittels Religionen und Gesetzen diejenigen Verhaltensweisen rational zu begründen, die aus den tierischen Instinkten direkt folgen würden. Einem Huhn dagegen ist die optimale Verhaltensweise bereits angeboren.
Noch überraschender ist vielleicht, dass auch das Bewusstsein in den meisten kritischen Situationen sogar schädlich zu sein scheint.
In Kampfsituationen, bei Angst, Wut oder Schmerz wird das Bewusstsein mehr oder weniger vollständig unterdrückt. Im Schreck weichen wir einem Wurfgeschoss oder einem Fahrzeug aus, lange bevor uns bewusst wird, was eigentlich geschah. Im Tischtennis wird kein Spieler bewusst darüber nachdenken, wie die Schläge ausgeführt werden müssen. Und ein Pianist wird während seiner Vorführung niemals bewusst darüber sinnen, welche Bewegungen die Zeichen auf seinem Notenblatt verlangen. Viele Grammatikregeln wenden wir spontan fast immer richtig an, und doch fällt es uns oft sehr schwer, sie genau in Worte zu fassen. Schlimmer noch: Je länger wir bewusst nach einer solchen Regel suchen, desto unsicherer werden wir dabei.
Sehr viele Dinge funktionieren unbewusst hundertmal besser als bewusst, sie müssen sogar automatisch und unbewusst ablaufen, um überhaupt ein brauchbares Resultat zu liefern.
5. Zeitliche Beschränkung der Gefahr
Wie wir am Beispiel des feindlichen Wiesels und einer möglichen Vergiftung bei der Nahrungssuche gesehen haben, bedeutet Lernfähigkeit, die ja immer auch Unwissenheit bei der Geburt voraussetzt, oft eine zusätzliche Gefahr. Dennoch sind Tiere nicht völlig lernunfähig. Es ist deshalb interessant zu schauen, in welchen Situationen Tiere lernen können. Denn es zeigt sich, dass Lernfähigkeit sich immer auf einen ganz bestimmten Lebensbereich bezieht.
Entscheidend für die Entwicklung von Lernfähigkeit ist immer die Frage: Lohnt es sich in einer bestimmten Situation, die Vorteile der Geborgenheit durch ein angeborenes Weltbildes gegen die Vorteile einer flexibleren Anpassungsfähigkeit einzutauschen?
Konrad Lorenz zeigte in einem berühmten Experiment, dass Entchen fähig sind, ihre Mutter kennenzulernen, indem sie sich das erste bewegte Ding, das ihnen in die Quere kommt, unwiderruflich einprägen. Schon wenige Minuten, nachdem die Entchen aus dem Ei geschlüpft sind, ist diese Einprägung unkorrigierbar.
Der Lernvorgang ist also bereits nach wenigen Minuten abgeschlossen. Diese enge zeitliche Begrenzung des Lernens schützt die Entchen wieder vor gefährlichen Experimenten beim Sammeln von Erfahrungen. Dass die Lernphase derart eng eingeschränkt ist, zeigt auch, wie wichtig es in der Natur ist, sich nicht zu lange der Gefahr des Lernen-Müssens auszusetzen. Aus demselben Grund wird das Lernen auf das absolut Notwendige beschränkt.
Das gesamte Verhaltensmuster des Entchens gegenüber der Mutter ist angeboren. Es wird lediglich noch das erste bewegte Ding in die bislang ‘weisse’ Stelle des Auslösereizes für das angeborene Kindverhaltens eingesetzt. Dies hat überhaupt nichts mit rationalem Weltverständnis zu tun. Die Entchen rennen nämlich auch einer Kartonschachtel an einer Schnur nach, wenn eine solche das erste bewegte Ding ist, das sie zu Gesicht bekommen.
6. Sprache als Multiplikator des Vorteils
Lernfähigkeit besitzen auch viel einfachere Tiere wie beispielsweise die Bienen mit ihrer weit ausgebildeten Begabung, neue Düfte mit Nahrungsquellen in Verbindung zu bringen. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass eine Biene, die sich von ihrer Körpergrösse her in jeder beliebigen Situation problemlos ernähren kann, dennoch die Gefahr einer Vergiftung auf sich nimmt, um eine neue Nahrungsquelle zu finden. Zwei Eigenschaften machen diese Gefährdung aber sinnvoll.
Erstens ist eine Arbeitsbiene nicht fortpflanzungsfähig. Das Genmaterial einer Biene überlebt nicht deshalb, weil die Arbeitsbiene überlebt, sondern weil sehr viele Arbeitsbienen optimal für den ganzen Bienenstaat sorgen. Der Tod einer einzelnen Arbeitsbiene beeinträchtigt die Überlebenschancen des Staates nicht. Die Erfassung neuer Nahrungsquellen bringt aber grosse Vorteile für den Staat und damit auch für das Überleben der Genmasse der Arbeitsbiene.
Dafür, dass die neue Nahrungsquelle wirklich voll ausgeschöpft werden kann, sorgt die zweite wesentliche Eigenschaft: Die berühmte Bienensprache. Es ist bemerkenswert, dass eine der inhaltsreichsten unter den Tiersprachen bei einem doch verhältnismässig einfachen Tier wie der Biene zu finden ist. Findet eine Honigbiene eine Futterquelle, so informiert sie mit einem komplizierten Tanz ihr Volk derart präzise über Richtung und Distanz des Fundortes, dass andere Bienen selbst kilometerweit entfernte Zielobjekte relativ zuverlässig finden. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Bienentänze nicht im Freien stattfinden, sondern an einer senkrechten Wand im Innern des Bienenstocks. Die Tänzerin muss demnach die zu vermittelnde Richtung aus der waagrechten Aussenwelt in die Senkrechte übertragen. Danach muss der Tanz von den Zuschauerinnen wieder in die Waagrechte zurückübersetzt werden, was scheinbar auf ein gewaltiges räumliches Vorstellungsvermögen hinweist, obwohl man heute mit Sicherheit sagen kann, dass diese Tanzsprache rein reflexartig abläuft.
Derselbe Code spielt auch bei der Suche nach einem neuen Nistplatz, also beim Schwärmen, eine Rolle. Hier begnügt sich die Kundschafterin nicht mit der Mitteilung des Ortes, sondern sie gibt auch noch die Qualität des Ortes zum Nisten bekannt. Weitere Kundschafterinnen begutachten darauf die Stelle, bis sich schliesslich nach zahllosen Erkundungsflügen und tagelangem ‘Wett-Tanzen’ der Entdeckerinnen das Volk mehrheitlich auf einen der Nistplätze einigt.
Dank der detaillierten Sprache kann eine Biene sehr vielen anderen Bienen exakte Angaben über die gefundene neue Nahrungsquelle machen. Dadurch kann der ganze Staat von der Neuentdeckung profitieren. Eine einzige, unfruchtbare Biene setzt sich einer Gefahr aus, und hunderte profitieren davon. Das bedeutet die Macht der Sprache! Wenn auf diese Weise der Vorteil einer Entdeckung multipliziert werden kann, lohnt es sich natürlich, die Gefahr und den Aufwand der Forschung in Kauf zu nehmen.
Lernfähigkeit taucht in der Evolution nicht willkürlich auf. Damit Lernfähigkeit überhaupt entstehen kann, muss mindestens eine der folgenden zwei Bedingungen erfüllt sein:
– Entweder muss das Erlernbare einem Individuum so grosse Vorteile im Überlebenskampf oder in der Fortpflanzung bieten, dass es sich lohnt, die damit verbundenen Gefahren einzugehen.
– Oder es müssen sprachliche Möglichkeiten bestehen, mit denen allfällige Vorteile einer Erkenntnis auf eine ganze Gruppe ausgedehnt werden können.
Beim zweiten Fall hat natürlich auch das forschende Individuum einen zusätzlichen Vorteil, denn es kann das Erlernte der Gruppe verkaufen. Der Gegenwert muss dabei nicht unbedingt materiell sein, sondern er kann auch die Form von Prestigegewinn oder Aufstieg in der Hierarchie haben.
7. Rentabilität des Lernens bei Schimpansen
Lernfähigkeit bezieht sich daher immer auf bestimmte Bereiche und sie entwickelt sich nur, wenn der Nutzen die Kosten überwiegt. In welchen Bereichen ist diese Bedingung bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen erfüllt? Wo lohnt sich die Lernfähigkeit für einen Schimpansen?
Affen verfügen nicht über eine sehr differenzierte Sprache. Sie benützen wohl einige Grunzlaute um ihre Stimmung auszudrücken, kennen mehrere verschiedene Warnrufe, die unterschiedliche Bedeutung haben und situationsgerecht angewendet werden. Aber diese Laute reichen bei weitem nicht aus, um die Erkenntnis einer Forschung anderen Gruppenangehörigen zu vermitteln.
Dagegen verfügen Affen und insbesondere Schimpansen über eine ausgesprochen gute Beobachtungsgabe und ein bemerkenswertes Imitationsvermögen. Wo eine Idee einen sichtbaren Vorteil bringt, kann sie deshalb sehr rasch von der ganzen Gruppe übernommen werden. Diese Ausgangsbasis setzt den Rahmen, in welchen Bereichen es sich für Schimpansen lohnt, lernfähig zu sein und zu forschen.
Gewiss kann es von Vorteil sein, in bestimmten Grenzen neue Nahrungsmittel zu testen und so kennenzulernen. Diese Aufgabe werden aber nicht die erfahrenen Führer der Gruppe übernehmen. Dafür wäre die Gefahr zu gross. Der Verlust eines ranghohen Gruppenmitgliedes samt seiner Kraft und Erfahrung wäre ein unnötiges Opfer. Das Testen neuer Nahrungsmittel ist deshalb die Aufgabe der unerfahrenen und leichter entbehrlichen Schimpansenkinder.
Diese Arbeitsteilung zeigt sich tatsächlich bei den vielzitierten kartoffelwaschenden Makaken (Waa 1). Ein junges Makakenweibchen entdeckte, dass Süsskartoffeln gewaschen viel besser schmecken, als mit Sand beschmutzte. Später wurde die Erfindung sogar noch weiter ausgebaut, indem zum Waschen vorwiegend Salzwasser verwendet wurde.
Obwohl dieses Kartoffelwaschen aber für jeden Makaken eine unbestreitbare kulinarische Aufbesserung sein musste, wurde die Erkenntnis lediglich rangabwärts weitervermittelt. Deswegen dauerte es zwar eine ganze Generation, bis sich die Neuerung durchgesetzt hatte. Es wurde aber nie ein ranghohes Tier in die Gefahr einer Vergiftung gebracht. Auch hier hat die Evolution also vorgesorgt, dass die Gefahr des Lernens so gering wie nur möglich gehalten wird.
Weit ausgebildet ist bei den Menschenaffen die Lernfähigkeit in Bezug auf den Werkzeuggebrauch. Jane van Lawick-Goodall beobachtete bei Schimpansen (Law 1):
– den Gebrauch von Stöcken als Waffe,
– gezieltes Werfen von Steinen gegen Feinde,
– den Gebrauch von Stecken als Untersuchungssonde (Ein Schimpanse stochert mit einem Stecken in einem morschen Holzklotz, einem Rucksack etc. und beschnuppert ihn dann. Wird eine Insektenlarve oder eine Banane aufgespürt, so lohnt es sich, das Holz, bzw. den Rucksack aufzureissen. Mittels solcher Sonden können auch ungewöhnliche Objekte, wie beispielsweise eine tote Pythonschlange untersucht werden.)
– den Gebrauch von Stöcken als Esswerkzeug zum Verzehr von Wanderameisen (um sich die äusserst schmerzhaften Bisse zu ersparen, vermeidet der Schimpanse so, dass die Ameisen über seine Arme krabbeln.)
– den Gebrauch von Grashalmen zum Termitenangeln,
– das Herstellen von Werkzeugen (z. B. Späne werden aus einem Holzklotz gebissen oder Blätter werden abgestreift, um einen Stecken als Werkzeug geeigneter zu machen.)
– Blätter, die der Schimpanse durchgekaut und somit absorbierfähiger gemacht hat, werden als ‘Schwamm’ gebraucht, mit dem Regenwasser aufgesaugt wird, das mit den Lippen nicht zu erreichen ist.
– mit dem Blatt-‘Schwamm’ wird das Schädelinnere eines erlegten Pavianbabys ausgewischt, um auch der letzten Hirnreste habhaft werden zu können,
– Gebrauch von Blättern als Tupfer bei einer blutenden Wunde am Hinterteil, als Toilettenpapier bei Durchfall oder zum Abwischen von Dreck.
Zusätzlich ist beim Schimpansen die Verwendung von kräftigen Stöcken als ‘Hebel’, z. B. zum Öffnen von Bananenkisten, beobachtet worden, sowie die Verwendung eines Zweiges als Zahnstocher.
Allerdings war bei einem Versuch ein Schimpanse auch nach mehrmaligem Vorzeigen nicht in der Lage, eine Axt zum Abspalten eines Spanes als Termitenangel zu gebrauchen. Und dies, obwohl derselbe Schimpanse bei weichem Holz spontan den gewünschten Span herausbiss. (Bei den ersten Hominiden spricht man heute nur dann von ‘Werkzeug’, wenn Geräte gezielt mit Gegenständen bearbeitet wurden. Dies scheint es bei Tieren tatsächlich nicht zu geben.)
Mehrfach wurde festgestellt, dass einige dieser Fähigkeiten kulturell bedingt, also erlernt sind. Bei Schimpansen an der Elfenbeinküste wurde beobachtet, dass Schimpansen auf der einen Seite eines Flusses dank einer anspruchsvollen Technik mittels Steinen sehr harte Nüsse knacken konnten. Auf der anderen Seite des Flusses, unter exakt denselben Lebensbedingungen, war diese Technik den Schimpansen unbekannt.
Wie erwartet muss keine dieser Fertigkeiten von jedem Tier neu erfunden werden. Zwar ist es wertvoll, viele Erfinder in einer Gruppe zu haben. Die Schimpansen besitzen deshalb einen angeborenen Forschungstrieb zum Entdecken des Werkzeuggebrauchs. Sie hantieren ständig mit irgendwelchen Gegenständen herum und untersuchen deren Eigenschaften. Sie merken sich spezielle Effekte und können sie später in anderen Situationen zu ihrem Vorteil einsetzen.
Dennoch muss nicht jeder Schimpanse ein Genie sein und jeden Kunstgriff selber entdecken. Denn auch wenn Schimpansen keine Lautsprache besitzen, sind sie doch in der Lage, durch Imitation von anderen Schimpansen zu lernen. So geht eine einmal entdeckte Fertigkeit kaum mehr verloren. Der Vorteil wird also auf die ganze Gruppe übertragen und vervielfacht sich dadurch.
Gerade im Bereich des Werkzeuggebrauchs kann der Aufwand des Lernens zusätzlich stark durch das vorsprachliche Denken im Sinne eines geistigen Probehandelns verringert werden. Dieses Nachdenken über Probleme ist bei Schimpansen tatsächlich wiederholt beobachtet worden.
Wenn beispielsweise eine Banane so aufgehängt wird, dass sie zwar mit einem Stock unerreichbar ist, mit zwei zusammengesteckten Stöcken aber heruntergeholt werden kann, so wird es einem Schimpansen vielleicht nicht auf Anhieb gelingen, die Banane zu bekommen. In solchen Fällen kann man oft beobachten, wie sich Schimpansen nach einigen erfolglosen Versuchen zurückziehen und dabei ein nachdenkliches Gesicht machen. Plötzlich aber kommt ihnen der entscheidende Gedanke, und es gelingt ihnen mühelos, zwei Stöcke zusammenzustecken, um damit die Frucht hinunterzuangeln.
Man könnte dieses Nachdenken der Schimpansen eine Art geistiges ‘Probehandeln’ (mit real vorhandenen Gegenständen) nennen. Mit diesem geistigen Probehandeln kann natürlich viel Kraft gespart werden. Die Vermutung liegt daher nahe, dass Lernfähigkeit im Bereich des Werkzeuggebrauches immer mit einer mehr oder weniger gut ausgebildeten vorsprachlichen Denkfähigkeit verbunden ist.
Am Ende dieses Denkens steht aber immer das Experiment mit seinen potentiellen Gefahren. Auch der zeitliche Aufwand bleibt bestehen, und die notwendige geistige Abwesenheit bedeutet eindeutig eine gewisse Schwäche. Zudem braucht Denken eine enorme Energie. Das menschliche Gehirn verbraucht etwa zwanzig Prozent des gesamten Energieaufwandes des Körpers, obwohl es nur zwei Prozent des Körpergewichtes ausmacht. Ein derartiger Energieverbrauch muss durch ganz konkrete Vorteile aufgewogen werden.
Trotz einer gewissen Denkfähigkeit beim Schimpansen bleibt eine wesentliche Schwäche der ‘Forschungstätigkeit’ eines Schimpansen gegenüber der Forschung eines Menschen. Beim Schimpansen lohnt sich das Forschen nur dann, wenn es zu einem abgeschlossenen, anwendbaren Resultat führt. Wenn ein Affe sich überlegt, wie er eine Nuss aufkriegen könnte, so gelingt es ihm am Ende – oder es gelingt ihm nicht. Wenn es ihm nicht gelingt, so hat er lediglich Zeit verloren. Selbst wenn er bei seinen Überlegungen zu gewissen Erkenntnissen gelangt, so gehen diese Erkenntnisse doch spätestens bei seinem Tod verloren.
Wenn ein Mensch eine Nuss knacken will, so gelingt ihm das sehr oft auch nicht. Aber ein Mensch kann anderen Menschen von seinen gescheiterten Versuchen berichten. Er kann ihnen den Weg zu erfolgversprechenden Methoden zeigen. Vielleicht hat er bei seiner Forschung gewisse Werkzeuge oder Techniken entwickelt, die auf anderen Gebieten eine Anwendung finden. Der Mensch wird wie der Schimpanse sterben, vielleicht ohne die Nuss geknackt zu haben. Aber das Wissen des Menschen, die gefundene Teillösung wird weiterleben, weil der Mensch dank seiner Sprache sein Wissen auch weitergeben kann, wenn er es selber noch nicht anwenden kann.
Es muss deshalb angenommen werden, dass Schimpansen lediglich über Dinge nachdenken, in denen eine Hoffnung auf ein sehr bald anwendbares Resultat besteht. Es wäre für einen Schimpansen völlig wertlos, unabhängig von einer unmittelbaren Handlung oder einem unmittelbaren Bedürfnis über die Welt nachzudenken oder gar zu philosophieren.
8. Gibt es philosophierende Schimpansen?
Weshalb ist Denken für einen Schimpansen gefährlich?
Nachdenken, das sich nicht auf konkrete Handlungen bezieht, ist für jedes nicht sprachbegabte Wesen lediglich ein Nachteil. Ein Schimpanse, der nachdenkt, ist ein Schimpanse, der mögliche Feinde zu spät erkennt, der sich Leckerbissen wegschnappen lässt und die sozialen Beziehungen vernachlässigt. Ausserdem wird beim Denken so enorm viel Energie verschwendet, dass jedes Lebewesen, das nur zum Vergnügen denkt, stark handicapiert ist. Ein Schimpanse ist deshalb schon durch den jahrmillionenlangen Überlebenskampf so veranlagt, grundsätzlich nur über Dinge nachzudenken, die ihm oder seiner Gruppe einen Vorteil bringen könnten. Dieser Vorteil muss, spätestens vor dem Tod des Erfinders so deutlich sichtbar sein, dass andere Schimpansen die Entdeckung als Vorteil anerkennen.
Unter diesen Voraussetzungen kann es sich ein Affe schlicht nicht leisten, ein zerstreuter Theoretiker zu sein. Sein Denken wird ganz klar anwendungsorientiert bleiben. Nahrungsbeschaffung, Abwehr von Feinden und übermütigen Artgenossen und soziale Beziehungen: Das sind die Themen, in denen konkrete Vorteile erlangt werden können. Auf diese Themen wird sich das Schimpansendenken beschränken.
Grundsätzliche Gedanken zu physikalischen oder gar mathematischen und philosophischen Fragen lohnen sich für ein sprachloses Wesen nicht, sie bringen lediglich die oben erwähnten Nachteile.
Was wäre Einstein gewesen, hätte man ihm die Sprache genommen? Er wäre ein ungeschicktes, unaufmerksames, passiv herumsitzendes und asoziales Wesen gewesen, dem man nach Belieben die Bananen hätte wegstehlen können! Von der Gewalt seiner Erkenntnisse wäre ja nicht das geringste in Erscheinung getreten, von einer Anwendung ganz zu schweigen. Die Selektion hat mit Sicherheit verhindert, dass Gedanken über physikalische Gesetze beim Schimpansen auftauchen.
Erst wenn allfällige Erkenntnisse und vor allem auch nicht anwendbare Zwischenresultate mittels Sprache anderen Gruppenmitgliedern mitgeteilt werden können, besteht eine Chance, dass sich der Aufwand des Denkens einmal auszahlt. Durch die Möglichkeit der Kommunikation gewinnt die Idee enorm an Wert. Anders als der Einzelne kann eine Gruppe eine Kultur entwickeln und auch Teillösungen und neue Fragestellungen sammeln und neu kombinieren und sie vielleicht lange nach dem Tod des Entdeckers in einer direkten Anwendung nutzen.
Während bei sprachlosen Wesen ein ständiger Zwang zur erfolgreichen Anwendung besteht, rentiert beim Menschen die Forschung auch dann, wenn kein unmittelbarer Vorteil in Aussicht steht.
Gerade dieser vielleicht grundlegendste Unterschied zwischen dem menschlichen und dem tierischen Denken wird von sehr vielen Leuten nicht einmal als Vorteil erkannt. Immer wieder wird gefordert, die Wissenschaften sollen sich ausschliesslich nach den gesellschaftlichen Bedürfnissen richten. Gerade die Grundlagenforscher bekommen immer wieder die Frage zu hören: „Was bringen ihre Experimente denn ganz konkret?“
Tatsache ist, dass in der Geschichte der Wissenschaft gerade die umwälzenden Entdeckungen auf Forschungen beruhen, bei welchen die Forscher nicht die geringste Ahnung hatten, was dabei für die Gesellschaft herausschauen würde. Conradt schreibt dazu (Con 1):
„Galvani hatte weder die Energieversorgung noch alle die Möglichkeiten im Auge, die die Elektrizität heute bietet, als er sich mit Fröschen befasste. Als O. Heinrot und K. Lorenz die von ihnen geliebten Anatiden intensiv beobachteten, hatten sie nicht die Absicht, eine naturwissenschaftliche Basis für die Psychologie und Soziologie zu schaffen. Darwin und Mendel hatten ihrerseits sicher nicht vor, Hilfe für die Züchtung dickerer Erdbeeren und ertragreicherer Reben zu leisten. Röntgen hatte nicht die medizinische Diagnostik im Sinn, als er sich mit Entladungsröhren befasste. Wöhler konnte nicht vorhersehen, dass er die Voraussetzung für eine gigantische Kohlenstoffchemie schuf. Auch Antibiotika, Vitamine und Hormone wurden durch Zufall entdeckt.“
All diese Männer waren nicht einfach ‘sehr viel intelligenter’ als Schimpansen, wie man vielleicht bei oberflächlicher Betrachtung denken könnte. Sie hatten darüber hinaus noch eine qualitativ neue, ganz wesentliche Eigenschaft, die jedem Affen völlig fehlt: Sie hatten einen Trieb, auch auf irgendwelchen Gebieten zu forschen, auf denen keine Anwendungen absehbar waren.
Für einen Schimpansen wäre eine derartige ungerichtete Erforschung der Natur völlig undenkbar. Es fehlt ihnen dazu das grundsätzliche Interesse für das, ‘was die Welt im Innersten zusammenhält’. Ein solches Interesse brächte einem Schimpansen lediglich Schaden. Dies bestätigen auch oben aufgezählten Entdeckungen. Keine von ihnen hätte einer Schimpansengruppe auch nur den geringsten Vorteil gebracht. Keines der oben aufgezählten Genies konnte seine Entdeckung selber zu einer konkreten Anwendung bringen. Sie alle konnten lediglich ihre Erkenntnisse anderen Menschen präsentieren, nicht aber eine einsatzbereite Anwendung vorweisen und ohne fremde Hilfe einen Vorteil erlangen. In einer sprachlosen Gesellschaft, zum Beispiel unter Schimpansen, wären alle diese Entdeckungen mit dem Tod ihrer Entdecker unrettbar verlorengegangen.
Die Forscher hätten für nichts eine ungeheure Energie aufgewendet. Schimpansen mit einem derartigen Forschungstrieb wären deshalb in der Selektion stark benachteiligt, ohne der Gruppe auch nur den geringsten Vorteil zu bringen. Deshalb befasst sich kein Schimpanse sehr eingehend mit einem Forschungsgebiet. Seine Konzentration reicht dazu höchstens für fünfzehn bis dreissig Minuten. Fehlt bis dahin eine konkrete Anwendung, so wird die Sache fallengelassen.
Nur für den Menschen mit seiner gut ausgebildeten Sprache lohnt es sich, auf allen nur denkbaren Gebieten zu forschen, jede erdenkliche Frage zu stellen und auch ohne konkretes Ziel über die Welt nachzudenken. Sehr oft bringen diese Grübeleien keine brauchbaren Resultate. Aber bereits ein Bruchstück einer neuen Idee kann so wertvoll sein, dass alle Fehlschläge dadurch aufgewogen werden. Deshalb hat eine sprachbegabte Gruppe Interesse, die Bemühungen zu einer Erfindung zu fördern oder sogar Gedankengänge, die fern jeder Anwendung zu liegen scheinen, zu stützen. Wenigstens wird eine sprachbegabte Gruppe die geistige Abwesenheit der Erfinder und Denker nicht zu Angriffen zu missbrauchen. So erst wird der Denker überlebensfähig.
9. Weiterführende Artikel auf dieser Homepage
Die Evolution der Sprache
Weshalb gibt es sexuelle Fortpflanzung?
Der kartesische Dämon – ist die Welt nur eine Täuschung?
Solipsismus
Anthropisches Prinzip
10. Bücherempfehlungen
Philip Wehrli, ‘Das Universum, das Ich und der liebe Gott’, (2017), Nibe Verlag,
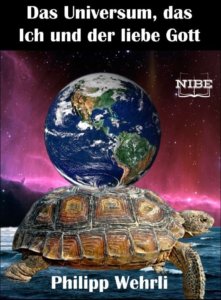
In diesem Buch präsentiere ich einen Gesamtüberblick über mein Weltbild: Wie ist das Universum entstanden? Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Was ist Bewusstsein und woher kommt es? Braucht es dazu einen Gott?
Viele Artikel dieses Blogs werden in diesem Buch in einen einheitlichen Rahmen gebracht, so dass sich ein (ziemlich) vollständiges Weltbild ergibt.
Leserunde bei Lovelybooks zum Buch ‘Das Universum, das Ich und der liebe Gott’, von Philipp Wehrli (abgeschlossen)
Rezensionen bei Lovelybooks
Rezensionen bei Amazon
Film-Präsentation zum Buch
Nibe Verlag
Cruse / Dean / Ritter, ‘Die Entdeckung der Intelligenz – oder Können Ameisen denken?‘, C. H. Beck´sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München, (1998)
Was schon die einfachsten Tiere spielend erledigen, treibt Roboterbauer und Computerprogrammierer an den Rand der Verzweiflung. Dieses Buch beschreibt, wie die Künstliche-Intelligenz-Forscher von der Natur lernen können.
von Ditfurth, Hoimar, ‘Der Geist fiel nicht vom Himmel’, dtv sachbuch, München 1980.
Ein scharfsinniger Überblick über die Evolution des Bewusstseins. Ditfurth zeigt, wie die Evolution neue raffinierte Organe hervorbringen kann, ohne zielgerichtet zu sein und er zeigt gleichzeitig, dass das Weltbild der meisten Tier völlig anders aussieht als das der Menschen. Unbedingt empfehlenswert!
Stamp Dawkins, Marian, ‘Die Entdeckung des tierischen Bewusstseins’, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1994.
Eines der am sorgfältigsten und kritischsten geschriebenen Bücher überhaupt zur Frage des tierischen Bewusstseins. Stamp Dawkins zeigt die erstaunlichen (und wissenschaftlich belegten) Leistungen des tierischen Denkens, widerlegt aber gleichzeitig die Vorstellung, Tiere seien genau wie wir.
van Lawick-Goodall Jane, ‘Wilde Schimpansen’.
Jane van Lawick-Goodall ist die erste Biologin, die Schimpansen in freier Wildbahn systematisch beobachtete.
Weitere Bücher zum Thema Bewusstsein
Weitere Bücher zum Thema Evolution

1 Antwort zu “Haben Tiere ein Bewusstsein?”